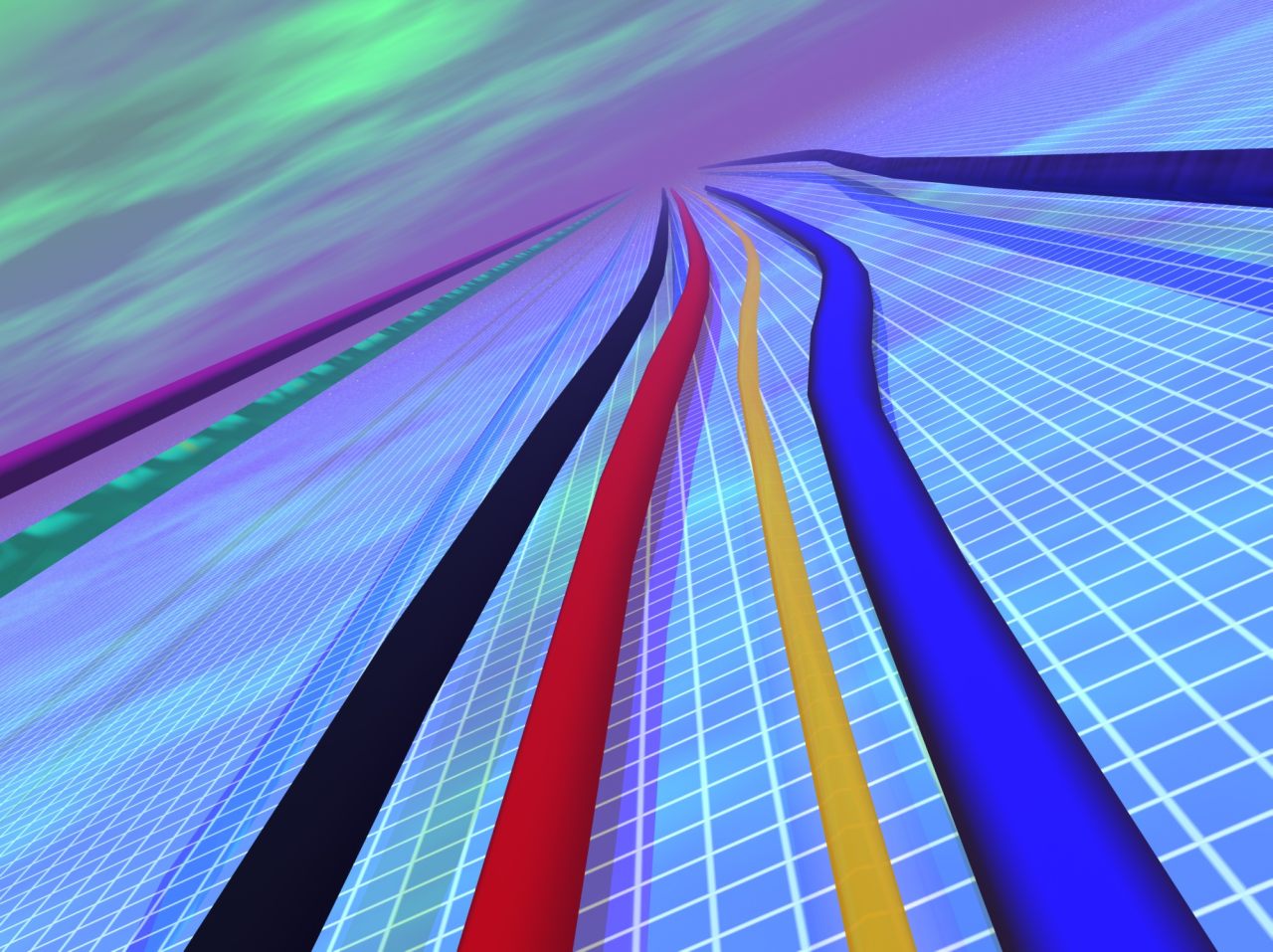von Jasmin Siri
Politik im digitalen Medium – Metamorphismus des Politischen?
Ich habe länger darüber nachgedacht, was ich im Anschluss an die StreitWert-Veranstaltung zur Frauen- und Geschlechterpolitik von Grünen und Piraten schreiben soll. Ich war mir zum Beispiel unsicher, ob ich an den programmatischen Unterschieden ansetzen will oder eher die ,lebensweltlichen’ Differenzen bespreche, die bei der Veranstaltung doch sehr augenfällig waren. Ich werde jetzt anhand von drei wichtigen Punkten einen Mittelweg versuchen und hoffe, dabei einige signifikante Differenzen zwischen Grünen und Piraten herauszuarbeiten. Es scheint, dass diese Differenzen weniger programmatischer Natur sind, sondern vor allem im Umgang mit dem Politischen und der Einschätzung der digitalen Welt begründet liegen.
I. Verfahren vs. Programmatik
Immer wieder werden Vertreterinnen und Vertreter der Piratenpartei dafür kritisiert, zwischen eigener Meinung und Parteimeinung zu differenzieren. Während Bündnis 90/ Die Grünen nun seit Jahrzehnten eine programmatisch gefestigte Gleichstellungspolitik vertritt und auch innerorganisational beachtet, besteht bei der Piratenpartei Uneinigkeit. Einerseits ist die Programmatik der Piraten hoch fortschrittlich, andererseits bestehen an der Basis erhebliche Vorurteile gegenüber dem Genderthema als solchem. Innerhalb der Piraten gibt es keinen Common Ground hinsichtlich der Genderfrage. Auf der einen Seite verfolgt der Kegelclub eine mit theoretischen Positionen gesättigte Genderpolitik. Auf der anderen Seite findet diese Position durchaus nicht nur freundliche Beachtung. So schrieb mir ein Pirat via twitter, das „Gender-Blöde“ zu den „Grünen zurück“ sollten „und Piraten piratige Inhalte“ schaffen sollten. Nicht wenige Piraten sind durch die Diskussion der Genderthematik offenbar entnervt. Und doch setzte sich programmatisch bisher eine progressive Haltung durch. Zum Beispiel wollen die Piraten das Ehegattensplitting abschaffen und die Versorgung schwacher Menschen und Kinder von der Blutsverwandschaft entkoppeln (vgl. zur Programmatik Siri & Villa in „Unter Piraten“ 2012, S. 156ff). Vertreter_innen der Piraten lösen diesen Widerspruch zwischen der Organisationsrealität und der Programmatik auf Nachfrage mit dem Hinweis auf eine Differenz von Parteimeinung und eigener Meinung.[i] Dies sind an den Fraktionsszwang, an Parteidisziplin (aber auch an Flügelkämpfe) gewöhnte Beobachter etablierter Parteipolitik nicht gewohnt. In etablierten Parteien ist es üblich, dass sich Politikerinnen und Politiker in öffentlichen Kontexten die Haltung der Organisation zu eigen machen und diese als die bestmögliche Haltung vertreten (vgl. Siri 2012). In der Piratenpartei steht jedoch nicht alleine die Durchsetzung der bestmöglichen Programmatik im Vordergrund der Debatte. Der basisdemokratische Anspruch und das Verfahren liquider Demokratie sind mindestens ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger für die Selbstbeschreibung der Partei. Hier fühlt man sich an die Anfänge der Grünen Partei erinnert, an Ideale der Basisdemokratie und große Plena. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die (zumindest in der Außenwirkung vorhandene) Ein-Themen-Politik: Hier die AKW’s und die Umweltzerstörung, dort die Einschränkung der freien Netze. Ob auch die Piraten bald ihre „Realos“ und „Fundis“ haben werden, bleibt abzuwarten, es scheint aber angesichts der eher „unpolitischen“ Sozialisation vieler Mitglieder (dies ein großer Unterschied zu den Grünen) eher unwahrscheinlich.
II. Differenzfeminismus vs. Post-Gender-Programmatik
In vielen feministischen Diskussionen ist ein wichtiger Streitpunkt die Unterscheidung zwischen Frauenpolitik und einer Politik, die über die binäre Unterscheidung von Frau und Mann hinaus gehen will, einer Politik des ,Post-Gender’. Während eine Position auf die Konstruiertheit des Geschlechts (und der Zweigeschlechtlichkeit) hinweist und daraus die Forderung nach einer Abkehr von starren Identitätsmustern und Fixierungen propagiert, interessiert sich die zweite vor allem für die Kritik am Patriarchat und die konkrete Verbesserung der Situation von Frauen. Dieser Streit flammt auch angesichts der Forderungen der Piraten auf. Eine dillematische Situation, die sich am Beispiel der Frauenquote vielleicht am besten illustrieren lässt: Auf der einen Seite fixiert eine solche Quote die Zweigeschlechtlichkeit, indem sie sie wiederholt, erst recht. Auch ist es legitim zu fragen, wieso es nur Quoten für Frauen und nicht für andere „marginalisierte“ Gruppen, seien es Menschen, deren sexuelle Identität sich der Zweigeschlechtlichkeit entzieht, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit geringer Bildung usw. usf., geben sollte. Auf der anderen Seite hat die Frauenbewegung für die Partizipation von Frauen am Politischen lange Kämpfe ausgestanden, und die Erfahrung hat gezeigt, dass Quoten (bisher!) der einzige produktive Weg sind, um eine ungefähr gleiche Repräsentation von Frauen und Männern (aber eben auch nur: „Frauen“ und „Männern“) in politischen Organisationen zu gewährleisten. Weiterhin weisen feministische ProtagonistInnen zu Recht darauf hin, dass ,post gender’ oder ,post-feminism’ eine popkulturell überformte, zutiefst antiemanzipatorische Losung sein kann (vgl. McRobbie 2004).
Eher in dieser Tradition bewegt sich die Programmatik der Grünen. Zwar wird, zum Beispiel im Männermanifest von 2010 auf die Gewordenheit des Geschlechts hingewiesen.
Gleichzeitig wird aber ein Zusammenhang zwischen Patriarchat und Krise aufgemacht: „Die Krise ist männlich. Klimakrise, Finanz- und Wirtschaftskrise, Hunger- und Gerechtigkeitskrise, all dies sind direkte Folgen einer vor allem ‚männlichen‘ Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweise, die unseren Planeten an den Rand des Ruins getrieben hat.“ Aus einer solchen Perspektive würde die Argumentation des ,post-gender’ vermutlich als eine neoliberale Chiffre verstanden, mit der es sich gesellschaftliche Akteure leicht machen und bestehende Geschlechterungerechtigkeiten verunsichtbaren. Hieraus erklärt sich vielleicht teilweise die Polemik, mit der feministische Akteurinnen wie EMMA in der Vergangenheit auf die Piraten reagierten. Eine weitere Kritik am ,post-gender’-Ansatz besteht darin, dass das Netz nicht geschlechterblind ist. So finden sich auch in Online-Interaktionen Geschlechtseffekte und Sexismus. Gleichzeitig ist das Verfahren des Liquid Feedback durchaus dazu geeignet, gesellschaftlich marginalisierten Gruppen einen besseren Zugang zur politischen Entscheidung zu erschließen.
III. Organisation vs. Bewegung: Metamorphismus des Politischen?
Ein großes Missverständnis hinsichtlich der Diskussion über und mit Piraten besteht sicher darin, sie im soziologischen Sinne als Partei zu begreifen und als eine einheitliche Organisation mit „einer Stimme“ zu adressieren. Dabei handelt es sich bei den Piraten „noch“ nicht um eine Parteiorganisation wie die Grünen oder die SPD, sondern um eine Bewegung mit Netzwerkcharakter, mit entsprechenden, der historischen Entwicklung geschuldeten Abstrichen, durchaus vergleichbar mit den Grünen bis ca. 1987. Aus der Sicht politischer Konkurrenten ist diese „Verwechslung“ sinnvoll, da so die Schwächen der Piraten – zum Beispiel eine nicht abgeschlossene Diskussion zur Genderthematik – offengelegt werden können. Zum besseren Verständnis trägt sie nicht bei. Wichtiger wäre es, die Ursprünge der internationalen Piratenbewegung im Free-Internet-Movement nachzuvollziehen und so ein Gespür für die spezifische Idee der Deliberation zu bekommen, welche die Kommunikation der Piraten prägt. In dieser spielt bspw. die Toleranz für abweichende Positionen eine weitaus höhere Rolle als der Kampf zwischen Flügeln, für den die Parteien des linken Spektrums bekannt sind. Nicht nur hinsichtlich der Gender-Frage, auch hinsichtlich der Links-Rechts-Unterscheidung bevorzugen viele Piraten eine Logik des „Dazwischen“ und der Irritation des Bestehenden. Vermutlich kann man die Piraten ohne einen unvoreingenommenen Blick ins Netz nicht verstehen.
Dass es schwer ist, über die Piraten zu schreiben und zu sprechen liegt also nicht nur daran, dass wir es mit einer jungen und schnell gewachsenen Bewegung zu tun haben, sondern auch daran, dass die Diskussion immer auch eine Diskussion medialen Wandels ist. In den letzten Wochen nimmt die Netzgemeinde amüsiert Kenntnis von einem neuen Diskurs um den (jetzt sogar lebens-)gefährlichen Computer und Online-Sucht. Hier schwelt in der Tat ein Konflikt, der auch die Diskussion in Berlin mitprägte: der zwischen Digital Natives und ihren „Vorfahren“ und den Digital Immigrants, die dem Medium mit Misstrauen begegnen. Dies ist alles nichts Neues: Auch dem Radio und dem Fernseher wurden einst schlimme Verführungskünste mit üblen Folgen für die (vor allem junge) Seele nachgesagt. Anders als das Radio und das Fernsehen wird aber – und dies ist ein wichtiger Punkt – das Internet nicht ,konsumiert’, sondern das Netz ist ein Teil der Lebenswelt. Das Netz ist nicht virtuell, sondern überaus real. Zu unterschätzen, welch politisches Potential in dieser Form der Vergemeinschaftung liegt; das wäre in der Tat eine wirklich gefährliche Form „digitaler Demenz“.
–
Dr. Jasmin Siri ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der LMU München. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind politische Soziologie, Organisationssoziologie und Mediensoziologie. Aktuell forscht sie vor allem zur politischen Kommunikation im digitalen Medium. Zuletzt von ihr u.a. erschienen: Parteien. Zur Soziologie einer politischen Form bei Springer VS und The Political Network – Parteien und politische Kommunikation auf Facebook. In: Kommunikation @ Gesellschaft – „Phänomen Facebook“, gem. mit Miriam Melchner und Anna Wolff. Online abrufbar unter: http://www.ssoar.info/ssoar/View/?resid=28273.
[i] So auch in der diesem Blogbeitrag vorausgegangenen Diskussion, als Schramm und Schlömer erklärten, dass in Ihrer Partei hinsichtlich der Einführung einer Frauenquote kein Konsens bestünde. So weit seien die Piraten noch nicht. Eine Oktroyierung ,von oben’ käme keinesfalls in Frage. Aus dem Publikum erfolgte hierauf z.B. der Ruf: „Dann geht in eine andere Partei!“ Für einige Anwesende war es schwer verständlich, dass die eigene Sicht der Dinge zugunsten des Ideals der Basisdemokratie zurückgeschraubt wurde – und das offen zugegeben wird.